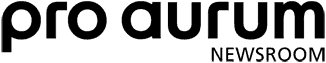Eines hat US-Präsident Donald Trump seit seiner Amtsübernahme definitiv geschafft: Das Vertrauen in den Dollar ist erodiert und das Vertrauen in Gold explodiert. Mit dem Dollarindex ging es nämlich 2025 um acht Prozent bergab und mit Gold um über 25 Prozent bergauf (Stand: 16.04.25).
Notenbanken besitzen 17 Prozent der globalen Goldmenge
Doch für diese Entwicklung ist nicht ausschliesslich Trumps chaotische Politik verantwortlich, die internationalen Notenbanken – insbesondere aus den Schwellenländern – haben ihre Goldreserven in den vergangenen Jahren auch aus anderen Gründen massiv aufgestockt. Wichtig zu wissen: Laut Daten des World Gold Council befinden sich derzeit 17 Prozent der jemals zu Tage geförderten Goldmenge – also ungefähr 37.755 Tonnen – in den Tresoren der Notenbanken. Im Grunde kann man unter diesen relativ wichtigen Marktakteuren zwei Strategien ausmachen. Industrienationen halten an ihren „Goldschätzen“ fest, während vor allem Staaten wie Russland und China sowie einige Länder des globalen Südens verstärkt als Käufer in Erscheinung treten. Für die meisten Zentralbanken ist der Goldverkauf derzeit indes kein Thema.
Die offiziellen Goldbestände einiger Zentralbanken fallen bei den folgenden Ländern am höchsten aus: USA (8.133,5 Tonnen), Deutschland (3.351,5 Tonnen), Italien (2.451,8 Tonnen), Frankreich (2.437,0 Tonnen), Russland (2.329,6 Tonnen), China (2.289,5 Tonnen), Schweiz (1.039,9 Tonnen), Indien (879,0 Tonnen), Japan (846,0 Tonnen) und die Türkei (622,6 Tonnen). Erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang aber auch die Goldbestände des IWF (2.814,0 Tonnen) und der EZB (506,5 Tonnen).
In den USA hat eine mangelnde Transparenz und die lange Zeitspanne seit der letzten vollständigen Prüfung (1953) zu Spekulationen geführt, dass Teile des Goldes in Fort Knox möglicherweise veräussert, verliehen oder verpfändet wurden, ohne dass dies öffentlich bekannt gemacht wurde. Besonders interessant: Donald Trump und Elon Musk, die öffentlich Zweifel an der Existenz der vollständigen Goldreserven in Fort Knox äusserten, haben in den ersten Monaten nach der Amtseinführung eine unabhängige Überprüfung gefordert. Bei China vermuten einige Experten, dass das Riesenreich mehr Gold besitzt, als es offiziell zugibt.
Notenbanken im Dauer-Kaufrausch
Das aktuelle Kaufinteresse des Notenbankensektors bei Gold kann man keineswegs als neues Phänomen bezeichnen, schliesslich hat der World Gold Council in seinem aktuellen Quartalsbericht (Gold Demand Trends) für das Jahr 2024 Nettokäufe in Höhe von insgesamt 1.044,6 Tonnen Gold gemeldet. Damit landeten das dritte Jahr in Folge mehr als 1.000 Tonnen der altbewährten Krisenwährung in den Tresoren der Zentralbanken. Seit dem Jahr 2010 haben sich deren Goldreserven somit um über 8.850 Tonnen erhöht.
2024 tauchten unter den Käufern überraschenderweise die Notenbanken einiger europäischer Länder wie z.B. Polen, Tschechien, Ungarn und der Türkei auf. Die polnische und tschechische Zentralbank gehörten mit Nettokäufen von 89,5 Tonnen (Rang 1) bzw. 20,5 Tonnen (Rang 4) sogar zu den Top-Five-Nationen. Deren Goldquoten an den Währungsreserven unterschreiten mit 19,1 Prozent bzw. 3,3 Prozent die Vergleichswerte von Ländern wie Deutschland (75,6 Prozent), Frankreich (73,2 Prozent) und Italien (72,4 Prozent) allerdings deutlich, was somit weiteres Nachholpotenzial eröffnet.
Die jüngste politische Entwicklung in den USA dürfte dem Vertrauen in die US-Währung eher schaden als nutzen. Auch dieser Sachverhalt ist keineswegs neu, schliesslich nutzen die USA die Noch-Weltleitwährung und ihre daraus resultierende Dominanz bereits seit vielen Jahren als Druckmittel gegen andere Staaten. Russland und der Iran haben dies durch das Einfrieren von Dollar-Guthaben und den Ausschluss wichtiger Banken vom Swift-System zu spüren bekommen. Dies hat deren internationalen Zahlungsverkehr erheblich erschwert und der dortigen Wirtschaft extrem geschadet. Auch die Europäer haben mit ihren Sanktionspaketen – insbesondere gegen Russland – gezeigt, dass die Euro-Bestände von Ländern oder deren Oligarchen bzw. Regierungsvertreter keineswegs frei handelbar und vor allem jederzeit verfügbar und im Extremfall sogar konfiszierbar sind.
BRICS-Staaten beschleunigen Entdollarisierung
BRICS ist ein informeller Zusammenschluss, dem mittlerweile nicht nur die fünf grossen Schwellenländer Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika angehören, sondern der inzwischen um fünf weitere Staaten aus dem globalen Süden erweitert wurde: Ägypten, Äthiopien, Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate und Indonesien. Darüber hinaus wurden neun Länder als Partnerstaaten aufgenommen. Sie alle versuchen, eine multipolare Weltordnung als Gegengewicht zum Westen aufzubauen. Vor allem China und Russland haben sich zum Ziel gesetzt, die Dominanz westlicher Industriestaaten im globalen Finanzsektor zu beenden.
Bei diesem Vorhaben kommen auch der Bitcoin und Gold immer wieder zur Sprache. Letztgenanntes kann man bspw. als „geopolitisches Notfallgeld“ bezeichnen. Goldreserven sind in physischer Form grenzüberschreitend akzeptiert und politisch neutral – also nicht vom Westen „abschaltbar“. Staaten wie Russland, China sowie der Iran, die andere Staaten regelmässig bedrohen und mitunter sogar überfallen, setzen gezielt auf Gold, um die Sanktionen des Westens zu umgehen. Vor allem China und Russland haben ihre Goldreserven in den vergangenen Jahren massiv aufgestockt – ein Schelm, wer Böses dabei denkt? Teilweise wird Gold sogar als Zahlungsmittel genutzt, wie z.B. bei Energiegeschäften zwischen dem Iran und der Türkei.
Gibt es genug Gold für die Welt?
Weil immer mehr Notenbanken im Zuge der wachsenden geopolitischen Spannungen ihre nationalen Goldreserven aufstocken, stellt sich vor allem die Frage, ob es derzeit genügend Gold gibt, um eine steigende Goldnachfrage ohne entsprechend starke Preiszuwächse zu bedienen. Wichtig zu wissen: In den vergangenen drei Jahren wurden allein von Notenbanken zwischen 28,5 und 29,7 Prozent der globalen Minenproduktion „absorbiert“. Doch im Gegensatz zu Fiat-Währungen kann man die Fördermengen von Gold nicht auf „Knopfdruck“ erhöhen. Hierfür ist nämlich viel Energie, Arbeit und Kapital nötig. Deshalb schwankte die primäre Goldproduktion seit 2010 in der relativ überschaubaren Bandbreite von 2.754,5 Tonnen (2010) und 3.658,4 Tonnen (2018).
Um eine echte Unabhängigkeit gegenüber anderen Staaten zu erzielen, müssen Notenbanken Gold allerdings in physischer Form besitzen. Papiergold gilt zwar als liquide und kostengünstiges Goldinvestment, weist allerdings einen grossen Nachteil auf: Ihm haftet stets ein gewisses Kontrahentenrisiko und im Worst-Case-Szenario sogar ein Totalverlustrisiko an. Notenbanken müssen in unsicheren Zeiten zudem entscheiden, wo sie ihre Goldbestände lagern.
Historischer Exkurs: Der Grossteil der deutschen Goldreserven wurde während des Bretton-Woods-Systems angehäuft, also in der Zeit des Wirtschaftswunders ab 1952. Damals konnten die Notenbanken ihre dollarnotierten Handelsüberschüsse in Gold tauschen und erhielten für 35 Dollar eine Feinunze Gold. Dank steigender Exportüberschüsse kletterten die deutschen Goldreserven bis Ende 1968 auf den Höchstwert von 4.033,78 Tonnen. Wegen des damaligen „Kalten Kriegs“ wollte die deutsche Bundesregierung aber lediglich einen kleinen Teil der Goldreserven im eigenen Land lagern und verteilte sie von 1957 bis 1997 auf folgende Finanzplätze: New York, London, Ottawa, Paris, Bern und Frankfurt.
Dies änderte sich mit dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ und das Gold wurde nach Frankfurt geholt. Während sich die Bank of England und die Schweizerische Nationalbank im grossen Stil von Gold getrennt hatten, blieb die Deutsche Bundesbank dem ultimativen Krisenschutz treu.
Von 2013 bis 2017 hat sie insgesamt 674 Tonnen Gold aus New York und Paris nach Frankfurt verlagert, um dort mindestens die Hälfte der staatlichen Goldreserven zu verwahren. Heute ist das Gold der Deutschen auf die drei Finanzplätze Frankfurt (50,0 Prozent), London (13,0 Prozent) und New York (37,0 Prozent) verteilt. Die höhere Lagerung von Gold in New York im Vergleich zu London begründete die Bundesbank bislang mit historischen, sicherheitspolitischen und währungspolitischen Überlegungen. Ob sich diese Entscheidung als richtig erweisen wird, erscheint angesichts des aktuellen Gebarens von US-Präsident Donald Trump jedoch fraglicher denn je.
Fazit: Angesichts der Tatsache, dass die Schuldenberge der wichtigsten westlichen Industrienationen stark steigen und deren Notenbanken an ihren Goldreserven seit vielen Jahren festhalten, sollten die Bundesbürger diesen Sachverhalt stets im Hinterkopf behalten und in Abhängigkeit von ihrer Risikobereitschaft – gemäss der Hausmeinung von pro aurum – eine Goldquote zwischen 10 und 20 Prozent des liquiden Geldvermögens anstreben oder zumindest beibehalten.
Bildquelle: alexandarilich
Bildnummer: 578797642
Bildquelle: istockphoto.com
Immer aktuell informiert: Folgen Sie pro aurum
So verpassen Sie nichts mehr! Informationen und Chartanalysen, Gold– und Silber-News, Marktberichte, sowie unsere Rabattaktionen und Veranstaltungen.
Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter
Der pro aurum-Shop
Die ganze Welt der Edelmetalle finden Sie in unserem Shop: proaurum.ch