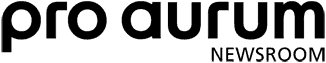Wie verändert KI die Kommunikation? Prof. Dr. Cornelia Wolf von der Uni Leipzig spricht über neue Tools, ethische Maßstäbe und die besonderen Herausforderungen für Start-ups – und sie erklärt, warum Kommunikation zur Chefsache wird.
Frau Prof. Wolf, inwiefern verändert der Einsatz von Künstlicher Intelligenz die strategische Kommunikation in Unternehmen?
Künstliche Intelligenz verändert die strategische Kommunikation grundlegend – insbesondere in der Interaktion mit Stakeholdern wie Kunden. Neben automatisch generierten Texten oder Bildern greifen KI-Anwendungen heute in alle Phasen des Kommunikationsmanagements ein: von der Datenanalyse bis zur Evaluation. Neue Formate wie Chat- oder Voicebots ermöglichen Echtzeit-Services, personalisierte Newsletter reagieren auf individuelle Nutzerbedürfnisse. Manche Unternehmen setzen sogar KI-generierte Avatare als synthetische Markenbotschafter ein. Die Herausforderung: Der Dialog wirkt echt, ist aber technisch vermittelt. Emotionale Nuancen oder Kontext können verloren gehen – gerade in Krisen- oder Vertrauenssituationen. Dennoch bietet KI enorme Chancen: schnellere Prozesse, individuellere Ansprache, effizientere Kommunikation.
Welche ethischen Überlegungen sollten Unternehmen berücksichtigen, wenn sie KI-gestützte Kommunikationsstrategien einsetzen?
Zentrale ethische Prinzipien sind Transparenz und Verantwortung. Stakeholder müssen erkennen können, ob sie mit Menschen oder KI-generierten Inhalten interagieren. Verschiedene Modelle liefern teils ideologisch gefärbte Antworten – abhängig von Trainingsdaten, Algorithmen und Herkunft. Unternehmen kaufen diese Technologien oft zu, ohne Einfluss auf die Modellarchitektur. Das macht klare Leitlinien und eine ausgeprägte Medienkompetenz unerlässlich. Orientierung bietet der EU AI Act mit Transparenzpflichten und der Unterscheidung zwischen normalen und Hochrisiko-Anwendungen. Kommunikationsabteilungen können daraus einen KI-Kodex ableiten, der Einsatzbereiche und Qualitätsstandards definiert.
Sie beschäftigen sich wissenschaftlich auch mit der Kommunikation von Start-ups. Welche spezifischen Herausforderungen und Chancen sehen Sie in der internen und externen Kommunikation von Start-ups im Vergleich zu etablierten Unternehmen?
In Start-ups spielt Kommunikation von Anfang an eine zentrale Rolle – sei es, um Investoren zu überzeugen und erste Kunden zu gewinnen oder um Sichtbarkeit im Markt aufzubauen. Gleichzeitig fehlt häufig die institutionelle Verankerung: Kommunikation ist stark auf das Gründerteam fokussiert, Ressourcen sind begrenzt. Erst bei bestimmten Meilensteinen wie Finanzierungsrunden, Krisen oder der Internationalisierung wird sie professionalisiert – etwa durch die Schaffung fester Stellen oder die Einbindung externer Unterstützung.
Wo Kommunikation etabliert ist, findet sie oft auf Augenhöhe mit dem Top-Management statt. Verantwortliche verstehen ihre Arbeit als wertschöpfend – etwa durch Lead-Generierung für Marketing- oder Vertriebsprozesse.
Intern zeigt sich ein anderes Bild: Besonders schnell wachsende Unternehmen erleben sogenannte „Wachstumsschmerzen“. Was in der Anfangsphase im direkten Austausch funktionierte, reicht bei 100 oder 500 Mitarbeitenden nicht mehr aus. Es braucht klar definierte Strukturen, geeignete Tools und abgestimmte Formate, um die interne Kommunikation auch in der Wachstumsphase effizient zu gestalten – ein Aspekt, der in vielen Start-ups noch unterrepräsentiert ist.
Wie beeinflusst der digitale Wandel die Entwicklung von Content-Strategien – insbesondere mit Blick auf crossmediale und multimediale Ansätze?
Der digitale Wandel hat Content-Strategien tiefgreifend verändert. Der Fokus liegt heute weniger auf dem Kanal als auf der Relevanz des Themas – ein Ansatz, den man als „Topic-driven Strategic Communication“ bezeichnet. Inhalte werden strategisch entwickelt und anschliessend mediengerecht ausgespielt – über Reels, Podcasts, Videos oder KI-gestützte Formate.
Damit diese Vielfalt zur Marke passt, ist eine konsistente und plattformübergreifende Kommunikation entscheidend. Viele Unternehmen setzen deshalb auf das Newsroom-Modell: Es trennt Themen- und Kanalverantwortung und sorgt für effizientere Prozesse.
Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Kommunikationsverantwortlichen: Sie brauchen journalistisches Denken, ein Gespür für Relevanz und die Fähigkeit, Inhalte formatübergreifend zu gestalten. Unternehmen kommunizieren heute zunehmend ohne Gatekeeper – direkt, kontinuierlich und auf eigenen Kanälen. Dadurch übernehmen sie neue Rollen im digitalen Informationsraum: quasi als Content-Häuser mit eigener redaktioneller Logik.
Welche Kompetenzen sind heute entscheidend, um strategische Kommunikation erfolgreich zu gestalten?
Kommunikation ist heute strategische Querschnittsfunktion – nicht nur Umsetzungsinstanz. Mitarbeiter in der Unternehmenskommunikation gestalten digitale Formate, beraten zu ethischen Fragen und begleiten Transformationsprozesse kommunikativ. Gerade Change- und digitale Kommunikation rücken enger zusammen. KI ist letztlich selbst ein grosser Veränderungsprozess – mit hohem Kommunikationsbedarf, intern wie extern. Institutionell spiegelt sich das im Aufstieg der Rolle des Chief Communication Officer wider, der zunehmend auf Top-Management-Ebene agiert. Heute braucht es neben Handwerk auch Analysefähigkeit, digitale Expertise, ethisches Urteilsvermögen und strategisches Denken.
Welche Trends werden die strategische Kommunikation in den kommenden fünf Jahren besonders prägen?
Neben der KI und damit dem Problem, zwischen echt und künstlich zu unterscheiden, sehe ich zwei grosse weitere Trends. Erstens: der Information Overload. Inhalte konkurrieren stärker denn je um Aufmerksamkeit. Unternehmen müssen sich als glaubwürdige Absender positionieren – mit geprüften Inhalten, Kontext und Relevanz. Wer sich als „Content Hub“ versteht, übernimmt Verantwortung in der digitalen Informationsordnung.
Zweitens: der steigende gesellschaftliche Druck zur Haltung. Besonders junge Zielgruppen fordern Positionierung zu Themen wie Nachhaltigkeit oder gesellschaftlichem Engagement. Das bringt Chancen, aber auch Spannungen – intern wie extern. Kommunikation muss Orientierung geben, Ambivalenzen aushalten und Diskussionsräume schaffen.
Strategische Kommunikation wird nicht einfacher – aber immer wichtiger. Sie gehört ins Zentrum der Unternehmensstrategie und muss ihre Erfolge sichtbar machen, etwa durch datenbasierte Evaluation. Nur so lässt sich ihr Wertbeitrag klar belegen.
Bildquelle: @CorneliaWolf
Immer aktuell informiert: Folgen Sie pro aurum
So verpassen Sie nichts mehr! Informationen und Chartanalysen, Gold– und Silber-News, Marktberichte, sowie unsere Rabattaktionen und Veranstaltungen.
Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter
Der pro aurum-Shop
Die ganze Welt der Edelmetalle finden Sie in unserem Shop: proaurum.ch