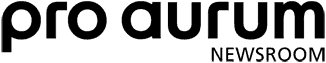Das Jahr 2025 ist bisher dies- wie jenseits des Atlantiks von einer rückläufigen Inflation gekennzeichnet. In den USA stellte sich ein Rückgang von 3,0 auf 2,4 Prozent p. a. ein und in der Eurozone rutschte sie von 2,5 auf 1,9 Prozent ab.
Inflationsanstieg relativ wahrscheinlich
Damit hat die Inflation erstmals seit September 2024 den von der EZB vorgegebenen Zielwert von zwei Prozent wieder unterschritten. In den USA – wo ebenfalls eine jährliche Teuerungsrate von 2,0 Prozent angestrebt wird – ist man davon noch ein gutes Stück entfernt. Dies und die Tatsache, dass Europas Konjunktur deutlich schlechter läuft als die US-Wirtschaft, dürfte auch der Hauptgrund sein, warum die europäischen Notenbanker in den vergangenen beiden Jahren bereits acht Zinssenkungen durchgeführt haben. In den USA gab es im selben Zeitraum lediglich drei Zinsreduktionen zu vermelden.
Doch nun droht den Konsumentenpreisen erhebliches Ungemach. Der militärische Konflikt zwischen Israel und dem Iran hat nämlich den Ölpreis innerhalb einer Woche um über zehn Prozent ansteigen lassen und könnte nun im Falle einer nachhaltigen Verteuerung des fossilen Energieträgers zu einem Comeback der Inflation führen. Zur Erinnerung: Im Oktober 2022 hat der Euro innerhalb eines Jahres 10,6 Prozent an Kaufkraft eingebüsst, US-Konsumenten mussten im Juni 2022 in der Spitze eine jährliche Teuerungsrate von 9,1 Prozent hinnehmen. Die seither zu beobachtende Entspannung an der „Inflationsfront“ war in erster Linie auf die Talfahrt des Ölpreises zurückzuführen.
Die von Eurostat für den Monat Mai veröffentlichten ersten Schätzungen lieferten hierfür den besten Beweis. Der Bereich „Energie“ nimmt innerhalb des repräsentativen Warenkorbs aktuell ein Gewicht von 9,4 Prozent ein und wies im Mai gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum einen Rückgang um 3,6 Prozent aus, während die beiden Sektoren „Lebensmittel, Alkohol und Tabak“ sowie „Dienstleistungen“ signifikante Preiszuwächse von 3,3 bzw. 3,2 Prozent verzeichnet hatten. Bei „Industriegüter“ war lediglich ein leichter Anstieg um 0,6 Prozent verzeichnet worden.
Zollchaos und Kriege verunsichern stark
Das Prognostizieren von Preisschwankungen war schon immer kein leichtes Unterfangen, aber in Zeiten wie diesen ist es noch deutlich schwieriger geworden. Derzeit gibt es zwei besonders schwer zu kalkulierende Unsicherheitsfaktoren: die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine sowie die Sprunghaftigkeit von US-Präsident Donald Trump, insbesondere in der Handels- und Aussenpolitik. Mit der Einführung von Zöllen möchte Trump Amerika wieder „grossartig“ machen und ausländische Firmen in die USA locken, damit diese dort produzieren und Menschen beschäftigen. Für erfolgreiche Investments sind auf lange Sicht aber zwei Dinge besonders wichtig, die bei Trump derzeit offensichtlich keinen hohen Stellenwert geniessen: Rechtsstaatlichkeit und Planbarkeit.
So geht die Mehrheit der Ökonomen und Institutionen (z. B. EZB, Fed, IWF oder OECD) davon aus, dass Zölle tendenziell inflationstreibend wirken. In der Regel verteuern nämlich höhere Zölle importierte Waren, wodurch höhere Produktionskosten entstehen, die dann meist zu höheren Endpreisen führen. Ausserdem beeinträchtigen hohe Zölle den Wettbewerb, da die Produkte ausländischer Anbieter „künstlich“ verteuert werden und dadurch für inländische Firmen eine grössere Preismacht entsteht, was in der Vergangenheit oftmals mit einer geringeren Rationalisierungsbereitschaft einhergeht.
Inflationssorgen der US-Konsumenten lassen nach
Der Indikator der Uni Michigan zu den Inflationserwartungen basiert auf monatlichen Umfragen unter US-Verbrauchern und misst, welche Inflationsraten sie in einem Jahr bzw. fünf Jahren erwarten. Er wird oft in den geldpolitischen Analysen der US-Notenbank verwendet, da er die subjektive Wahrnehmung zukünftiger Preissteigerungen im Alltag widerspiegelt. Mitte Juni wiesen beide einen Rückgang aus. Nachdem für den Monat Mai mit 6,6 Prozent (Zeitraum: ein Jahr) noch der höchste Stand seit November 1981 gemeldet wurde, rutschte er zuletzt auf 5,1 Prozent ab und markierte damit den niedrigsten Wert seit drei Monaten. Die Fünfjahreserwartung sank lediglich von 4,2 auf 4,1 Prozent. Damit haben sich die Inflationssorgen der Verbraucher zwar etwas abgeschwächt, allerdings dürfte darin die jüngste Entwicklung an den Ölmärkten noch nicht enthalten sein.
In Europa rechnen die Verbraucher übrigens laut einer von der EZB regelmässig durchgeführten Umfrage für die kommenden zwölf Monate mit einem Kaufkraftverlust von 3,1 Prozent (April) nachdem im Vormonat ein Wert von 2,9 Prozent ermittelt wurde.
Besonders interessant: Obwohl laut Statistischem Bundesamt die Verbraucherpreise im Jahr 2024 lediglich um 2,2 Prozent gestiegen sind, nimmt laut einer im Februar veröffentlichten Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) jeder zweite Befragte eine „starke“ Preissteigerung wahr. Im Durchschnitt wurde die Inflationsrate 2024 auf 15,3 Prozent geschätzt.
Um die vorprogrammierte Geldentwertung des Euros ausgleichen zu können, müssten die Einkommen der Konsumenten (nach Steuern) entsprechend steigen. Als deutlich zuverlässiger hat sich in den vergangenen Jahren der Erwerb des altbewährten Inflationsschutzes Gold erwiesen. Dessen Wertsteigerung dürfte Verbrauchern trotz „gefühlt hoher Inflation“ die Laune verbessert haben. Und daran dürfte sich auf lange Sicht höchstwahrscheinlich wenig ändern.
Bildnachweis: Ilja Enger-Tsizikov
Bildnummer: 1427587815
Bildquelle: www.istockphoto.com
Immer aktuell informiert: Folgen Sie pro aurum
So verpassen Sie nichts mehr! Informationen und Chartanalysen, Gold– und Silber-News, Marktberichte, sowie unsere Rabattaktionen und Veranstaltungen.
Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter
Der pro aurum-Shop
Die ganze Welt der Edelmetalle finden Sie in unserem Shop: proaurum.ch