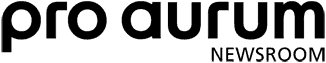Herr Hellmeyer, Frankreich wird zur Belastungsprobe für Europa, Premier Bayrou musste zurücktreten. Die Märkte zittern vor einer Neuauflage der Euro-Schuldenkrise – könnte Frankreich aus Ihrer Sicht das neue Griechenland werden?
Ein direkter Vergleich mit Griechenland verbietet sich – Frankreich verfügt über eine andere industrielle Substanz. Doch politisch ist die Lage kritisch: In den vergangenen zwei Jahren sind vier Regierungen gescheitert, Reformen zur Reduzierung der Defizite wurden nicht umgesetzt. Mit Haushaltslöchern von fünf bis sechs Prozent des BIP erodierte das Vertrauen.
Während Griechenland ein kleines Land war, das sich stabilisieren liess, reden wir bei Frankreich über die zweitgrösste Volkswirtschaft Europas – politisch blockiert und ohne Reformagenda. Zugleich verliert auch Deutschland an Wettbewerbsfähigkeit und kann nicht mehr die Rolle des Stabilitätsankers wie vor gut zehn Jahren übernehmen. Heute sind ausgerechnet die ehemaligen Krisenländer des Südens die Stabilisatoren, während Deutschland und Frankreich die Problemfälle sind.
Wenn hier nicht konsequent gegengesteuert wird, könnte diese Krise gravierender werden als die damalige Griechenland-Krise – mit weitreichenden Folgen für die Eurozone und den Euro.
Welche Chancen und Risiken sehen Sie derzeit für die Aktienmärkte – und halten Sie eine Jahresendrally für realistisch?
Aktienmärkte sollten nicht durch das Prisma einzelner Volkswirtschaften, sondern mit Blick auf die Entwicklung der Weltwirtschaft betrachtet werden, denn die in den Märkten gelisteten Unternehmen sind Global Player und optimieren Geschäftsmodelle und Standorte latent oder verlagern Letztere in zukunftsfähige Regionen. Das globale Wachstum liegt real bei drei und nominal bei sieben Prozent. Diese nominale Wachstumsrate spiegelt sich in den Bilanzen der Unternehmen. Krisen können kurzfristig belasten. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass nach Rückgängen oder Einbrüchen zügig Kaufinteressen einsetzten.
Bezüglich der favorisierten Standorte der Unternehmen kommt es zur Trennung der Spreu vom Weizen. Die Energiepolitik in Deutschland und Europa schwächt die Wettbewerbsfähigkeit. Im Gegensatz dazu setzen die USA und Grossbritannien auf Atomenergie und schaffen so die Grundlage für Innovation und Investitionen, denn ohne Energie geht nichts – gar nichts! Das verschafft ihren Volkswirtschaften strukturelle Vorteile.
Für die Märkte bedeutet das: Rückschläge sind jederzeit möglich, doch grössere Einbrüche sehe ich nicht. Die Positionierung ist defensiv, die Euphorie fehlt – und genau die wäre Voraussetzung für tiefe Korrekturen. Deshalb halte ich eine Jahresendrally mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 60 Prozent für realistisch.
Die US-Notenbank hat am Mittwoch die Zinsen wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Hat die Fed damit in erster Linie auf die abkühlende Konjunktur reagiert – oder doch auf den politischen Druck aus dem Weissen Haus?
Die US-Wirtschaft wächst im internationalen Vergleich stärker als die Eurozone, Japan und das Vereinigte Königreich, doch die Entwicklung ist nicht ausgewogen: Der Immobilien- und Bausektor steckt wegen der hohen Zinsen bereits in einer Rezession.
Entscheidend ist der Blick auf den Realzins, also den Nominalzins abzüglich Inflation. In der Eurozone liegt er derzeit bei etwa null Prozent, in Grossbritannien ist er leicht positiv, in Japan liegt er im negativen Bereich. In den USA beträgt er dagegen bei rund 1,4 Prozent am Geld- und bei 1,1 Prozent am Kapitalmarkt. Das ist gegenüber anderen westlichen Wirtschaftsräumen ein massiver Standortnachteil.
Daraus ergibt sich ökonomischer– weniger politischer – Druck auf die Fed, zu handeln. Ich halte weitere Zinssenkungen von insgesamt ein bis 1,25 Prozentpunkten in den kommenden neun Monaten für wahrscheinlich.
Die EZB hat hingegen entschieden, die Zinsen im September nicht weiter zu senken. Eine richtige Entscheidung?
Ja, das war die richtige Entscheidung. Der Realzins liegt im Euroraum derzeit bei rund null Prozent. Die EZB hat das Zinsniveau in den vergangenen anderthalb Jahren Schritt für Schritt gesenkt und will nun nicht unnötig weitere Munition verschiessen. Auch Bundesbankpräsident Nagel hat diese abwartende Haltung unterstützt.
Weitere Zinssenkungen sind aus meiner Sicht nur im Fall externer Schocks denkbar. Im Moment besteht dazu keine Notwendigkeit.
Die Inflation liegt derzeit im Euroraum bei zwei Prozent. Ist das Inflationsgespenst im Zuge von Corona und Ukraine-Krieg damit erst einmal besiegt?
Ja, aus meiner Sicht ist die Inflation vorerst besiegt. Europa profitiert stark von der Aufwertung des Euro: Seit Jahresbeginn stieg er von 1,02 auf 1,17 US-Dollar – ein Plus von rund 15 Prozent und ein deflationär wirkender Effekt.
Ob dieses hohe Euro-Niveau angesichts der Instabilität in Frankreich und Deutschland dauerhaft tragfähig ist, bleibt zwar fraglich. Doch aktuell entspannt es die Lage erheblich. Hinzu kommt, dass die Lohninflation moderat bleibt und Unternehmen die Kosten bislang gut abfedern können. Eine neue Preisspirale erwarte ich kurzfristig nicht.
Friedrich Merz hat einen „Herbst der Reformen“ angekündigt – mit Bürgergeld, Rente und Krankenversicherung als zentralen Themen. Sehen Sie darin die Chance, dass endlich ein Ruck durch Deutschland geht?
Jede Reform in Deutschland ist zu begrüssen – Reformen sind längst überfällig. Doch das angekündigte Reformmass bleibt überschaubar. Angesichts der schwachen Wirtschaftsentwicklung und einer absehbar schrumpfenden Steuerbasis reichen punktuelle Korrekturen nicht aus.
Eigentlich bräuchten wir eine Reformagenda, die doppelt so umfassend wäre wie jene unter Gerhard Schröder, um die Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen. Die jetzigen Massnahmen gehen zwar in die richtige Richtung, sind aber zu klein und zu zaghaft. Es fehlt an Mut, um Investitionen und Konsum nachhaltig zu beleben.
Die IAA ist vor ein paar Tagen in München zu Ende gegangen. Was muss aus Ihrer Sicht passieren, damit sich der Automobilstandort Deutschland behaupten kann?
Entscheidend sind bezahlbare Energie, Versorgungssicherheit und eine Politik, die Leistungsanreize setzt. Genau daran hapert es derzeit. Für die Automobilindustrie bedeutet das, dass Produktionsverlagerungen ins Ausland weiter zunehmen werden.
Gleichzeitig sehe ich eine Trendwende beim Thema Verbrenner. Inzwischen fordern selbst führende Politiker ein Umdenken, und auch die EU-Klimaziele für 2040 werden infrage gestellt. Das spricht dafür, dass der Verbrenner eine Zukunft hat – hier besitzt die deutsche Autoindustrie, insbesondere beim Diesel, klare Wettbewerbsvorteile.
Euphorie ist nicht angebracht, aber eine Trendwende ist erkennbar. Die deutsche Automobilindustrie sollte keinesfalls abgeschrieben werden.
Der Goldpreis kennt derzeit nur eine Richtung: nach oben. Allein in den vergangenen sechs Monaten machte das Edelmetall ein Plus von 25 Prozent. Hat Sie das überrascht?
Für mich ist das keine Überraschung – ich bin seit 2001 überzeugter Gold-Bulle. Der Anstieg spiegelt die strukturelle Schwäche des westlichen Finanzsystems wider. Die Politik Donald Trumps mag kurzfristig Erfolge bringen, doch langfristig untergräbt sie das Vertrauen in den US-Dollar.
Hinzu kommt die globale Machtverschiebung: Der Süden hat seinen Anteil an der Weltwirtschaft seit 1980 von 20 auf 70 Prozent ausgebaut, bald werden es wohl 80 sein – und qualitativ sind die Daten dort inzwischen besser als im Westen.
Ein entscheidender Punkt ist zudem die Einfrierung russischer Devisenreserven. Damit ist klar: Währungsreserven in Dollar oder Euro sind im Ernstfall nicht mehr unantastbar. Für viele Länder bedeutet das ein Risiko – und Zentralbanken reagieren, indem sie vermehrt Gold kaufen.
Kurzfristige Rücksetzer von fünf bis zehn Prozent sind möglich, doch der Trend bleibt positiv – nicht nur für Gold, sondern auch für Silber. Gold hat bereits neue Rekorde erreicht, Silber liegt noch deutlich darunter und hat Aufholpotenzial.
Donald Trump sorgt für eine immer engere Verzahnung der traditionellen Finanzbranche mit der Welt der Kryptowährungen. Was bedeutet das für Bitcoin und Co.?
Bitcoin hat den Edelmetallen zeitweise den Rang abgelaufen, bleibt aber hochvolatil. Dennoch bin ich heute zuversichtlicher als noch vor zwei, drei Jahren, dass Kryptowährungen Bestand haben werden – auch, weil sie politisch gewollt sind und im globalen Süden als Alternative für Zahlungssysteme dienen können.
Bitcoin wird seinen Platz behaupten, doch Edelmetalle bleiben unverzichtbar. Gold hat eine 5.000-jährige Erfolgsgeschichte, während Bitcoin allein auf Knappheit und Rechenleistung basiert. Das sind zwei völlig unterschiedliche Kategorien. Deshalb bleibe ich dabei: Edelmetalle sind das einzige wahre Geld.
Das Interview führte Benjamin Summa, Leiter Kommunikation bei pro aurum
Bildquelle: Folker Hellmeyer
Immer aktuell informiert: Folgen Sie pro aurum
So verpassen Sie nichts mehr! Informationen und Chartanalysen, Gold– und Silber-News, Marktberichte, sowie unsere Rabattaktionen und Veranstaltungen.
Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter
Der pro aurum-Shop
Die ganze Welt der Edelmetalle finden Sie in unserem Shop: proaurum.ch