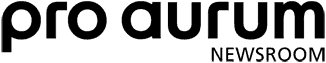Hugo Hagen erlebt den Goldmarkt seit mehr als sechs Jahrzehnten aus nächster Nähe – von der Kuba-Krise bis zu Rekordpreisen. Im Gespräch erklärt er, warum Gold in turbulenten Zeiten immer wieder Vertrauen gewinnt und welche Lehren er daraus gezogen hat.
Herr Hagen, Sie waren 1962 junger Banker, als die Kuba-Krise die Welt in Atem hielt. Obwohl der Goldpreis damals fest bei 35 Dollar lag, stieg die Nachfrage innerhalb kürzester Zeit stark an. Wie haben Sie diese Situation erlebt?
Hagen: Nach dem Krieg durften Banken in Deutschland erst ab Mitte der 1950er-Jahre wieder mit Gold handeln. Anfangs kauften Kunden vor allem alte Münzen aus der Zeit des Goldstandards – kleine Mengen, denn der wirtschaftliche Aufschwung setzte gerade erst ein. Als 1962 die Kuba-Krise die Welt erschütterte, schnellte die Goldnachfrage sprunghaft nach oben. Viele Menschen erinnerten sich an die Kriegsjahre, in denen Gold und Silber beim Tausch gegen knappe Güter halfen. Diese Erfahrung hatte tiefes Vertrauen in physisches Gold geschaffen – anders als bei Papierwerten, die schon einmal wertlos geworden waren. Damals war der Goldpreis im Rahmen des „London Gold Pool“ noch fest bei 35 US-Dollar pro Unze. Neu geprägte Münzen orientierten sich an diesem Preis, was den Handel für Anleger transparent machte – und das Interesse an Goldmünzen und Barren stetig wachsen liess. Für bekannte und gefragte Goldmünzen zu 20 Mark oder 20 Schweizer Franken mussten Aufpreise bezahlt werden.
In den folgenden Jahrzehnten galt Gold immer wieder als unmodern – viele Banken haben den Handel ganz aufgegeben. Warum haben Sie persönlich nie an seinem Wert gezweifelt?
Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung gewann die D-Mark schnell das Vertrauen der Menschen zurück. Sparkonten, Pfandbriefe und Anleihen boten reale Zinsen – das hielt die Goldnachfrage gering. Für Banken war es zudem lukrativer, Kundeneinlagen für Kredite zu verwenden, statt einmalig Gold zu verkaufen. Das Kreditgeschäft hatte Vorrang, der Ausbau des Goldhandels spielte kaum eine Rolle. Dennoch blieb Gold im Bewusstsein der Menschen präsent – weniger als Anlage, sondern eher als wertvolles Geschenk zu Weihnachten, Geburtstagen oder Firmenjubiläen.
Mit dem Ende der Goldpreisbindung Anfang der 1970er-Jahre wurde Gold von der Währung zum frei gehandelten Rohstoff. Erst dadurch konnte der Preis von 35 Dollar auf rund 850 Dollar im Januar 1980 steigen. War diese „Befreiung“ die Geburtsstunde des modernen Goldmarkts?
Anfang der 1970er-Jahre gerieten die USA durch ein wachsendes Handelsbilanzdefizit und abfliessende Goldreserven unter Druck. 1971 wurde der offizielle Goldpreis auf 38 US-Dollar angehoben – ein letzter Versuch, das alte System zu stabilisieren. Kurz darauf gaben die Zentralbanken den „London Gold Pool“ auf, und der Goldpreis bildete sich erstmals frei am Markt. Mit der Aufhebung der Dollarbindung, steigender Inflation, geopolitischen Spannungen und dem Vertrauensverlust in Papiergeld begann eine neue Ära. Ja, man kann das so nennen: die Geburtsstunde des modernen, freien Goldmarktes.
Was haben die Anleger Anfang der 1980er-Jahre getan, nachdem sich der Goldpreis seit 1976 verachtfacht hatte – weitergekauft oder eher panisch verkauft?
Ich erinnere mich an einen Hotelier, der rund 100 Krügerrand-Münzen verkaufte, um seinen Betrieb zu erweitern. Im Grossraum München wurden Erlöse aus dem Verkauf von Agrarflächen häufig in Gold reinvestiert – als Form der Sachwertanlage. Daneben dominierten kleinere Käufe für Geschenkzwecke und regelmässige Zukäufe von Barren oder Anlagemünzen. Die aufwendige Beratung von Sammlern überliessen viele Banken spezialisierten Numismatikern – auch mangels eigenen Fachpersonals.
In den 1980er- und 1990er-Jahren geriet Gold in Vergessenheit. Wie war das für einen Gold-Bug wie Sie?
Ende der 1970er-Jahre sorgten Inflation, Ölpreisschocks und geopolitische Krisen für eine regelrechte Edelmetallhausse. Zwischen Dezember 1979 und Januar 1980 stieg der Goldpreis auf über 800 US-Dollar je Unze, Silber erreichte fast 50 US-Dollar – getrieben von Unsicherheit und schwindendem Vertrauen in Papiergeld. In Deutschland führte die neue Besteuerung bislang steuerfreier Münzen wie Krügerrand und Maple Leaf zu einem Nachfrageeinbruch. Nach dem steilen Anstieg folgte eine rasche Korrektur – eine Mahnung, dass Käufe in euphorischen Phasen selten klug sind. In den 1980er- und frühen 1990er-Jahren geriet Gold tatsächlich aus dem Blickfeld vieler Anleger. Mit der Steueraufhebung 1993 belebte sich der Markt jedoch wieder: Negative Realzinsen, ein schwächerer US-Dollar und steigende Preise in D-Mark brachten viele Investoren zurück zu Gold und Silber. In all den Jahren war die starke Goldnachfrage in Indien und den arabischen Ländern ein prägender Faktor, der den Markt stabilisierte und zeitweise preistreibend wirkte. Für mich persönlich war das keine Durststrecke – eher die Bestätigung, dass wahre Werte auch dann Bestand haben, wenn sie gerade niemand beachtet.
Sie haben pro aurum mit aufgebaut, kurz bevor Gold wieder an Bedeutung gewann. Welche Idee stand damals im Mittelpunkt?
Bitte keine Überhöhung: Ich habe pro aurum nicht „mit aufgebaut“. Die Geschäftsführer sassen jahrelang mit mir am Händlertisch; ich habe Detailfragen beantwortet, historische Einordnung gegeben und durch die Weitergabe von Praxiswissen – Abwicklung, Versand, Einarbeitung neuer Kolleginnen und Kollegen, Schulungen – den Rücken freigehalten. Mehr Mentor als Gründer. Die Gründungsidee entstand aus einer klaren Marktlücke: Gross- und Filialbanken zogen sich aus dem physischen Edelmetallgeschäft zurück, zugleich wuchsen in Krisenzeiten das Bedürfnis nach realen Werten und die Nachfrage in der Breite. pro aurum wollte diese Lücke schliessen – mit einem starken Privatkundengeschäft und der Fähigkeit, auch kleinere Banken zuverlässig zu versorgen. Der Anspruch war von Beginn an Bankenniveau: transparente, laufende Preisstellung nach den Entwicklungen im Schweizer oder Londoner Freiverkehr, saubere Prozesse und verlässliche Logistik.
Heute steht Gold bei rund 4.000 US-Dollar – ein historischer Höchststand. Welche Entwicklungen treiben diesen Rekordlauf?
Die vergangenen drei Jahre erinnern mich an die Wendezeit 1989/90: eine Ballung politischer Konflikte und wirtschaftlicher Belastungen – von Handelsbilanzdefiziten, Zöllen und Exportschwäche bis zu Firmenpleiten und steigender Arbeitslosigkeit. Viele Staaten sind hoch verschuldet, auch Deutschland. Das von EU-Ländern bei der EZB hinterlegte Sicherheitenvolumen deckt die umlaufende Geldmenge nicht ansatzweise, wenn man es an einem Goldpreis von 4.000 US-Dollar misst. Bemerkenswert ist, dass selbst Notenbanken das einst „demonetisierte“ Gold wieder zukaufen. Die physische Nachfrage übersteigt das Angebot; auch Terminverkäufe der Minen müssen letztlich mit Ware gedeckt werden. Gold lässt sich nicht drucken – Förderung und Aufbereitung brauchen Vorkommen, Kapital und vor allem Zeit. Diese Gemengelage erklärt den Rekordlauf. Und die Stimmung am Markt spiegelt das wider: Auf einer Münchner Messe sagte mir ein Besucher schlicht – lieber Gold im Safe als Bitcoins im Computer.
Sie haben es erwähnt: Weltweit kaufen Notenbanken in grossem Stil Gold. Ist das Misstrauen gegenüber den Leitwährungen – oder einfach strategische Vorsorge?
Zentralbankkäufe sind vor allem strategische Vorsorge. Trotz aller Versuche der „Demonetisierung“ blieb Gold für Notenbanken stets Reserve- und Vertrauensanker. 1991 wurde etwa für die Aufnahme des Rubels in den freien Handel sogar eine Golddeckung ins Spiel gebracht. Auch die Staaten des ehemaligen Goldpools hielten Gold weiter als Reserve beziehungsweise Teildeckung ihrer Währungen. Der Grund ist zeitlos: Gold ist knapp, nicht beliebig vermehrbar, global handelbar und weltweit begehrt. In Phasen erhöhter Inflationstendenzen oder wachsender Zweifel an Leitwährungen stärkt es die Resilienz einer Bilanz. Kurz: Es geht weniger um spektakuläres Misstrauen, mehr um nüchterne Diversifikation und Absicherung – dieselben Motive, aus denen auch Privatpersonen Gold erwerben.
Viele Privatanleger fragen sich, ob es jetzt zu spät ist, noch einzusteigen. Was sagen Sie?
Heute agieren Spekulanten vor allem über Termingeschäfte, Optionen, Minenaktien oder ETFs – dort entfallen physische Transaktionen, was enge Spannen und schnelle Gewinne ermöglicht. Private Anleger dagegen suchen im physischen Gold seit Jahrtausenden den verlässlichen Gegenpol: einen realen, greifbaren Sachwert als Teil ihrer Reserve oder Altersvorsorge. Für den Abbau der weltweit wachsenden Staatsverschuldung sehe ich keine kurzfristige Lösung. Der Goldpreis bleibt daher ein Spiegelbild von Angebot und Nachfrage, vom Außenwert des US-Dollar und der jeweiligen Landeswährung. Ob es zu spät ist, einzusteigen? Ganz im Gegenteil: Wer schrittweise investiert – etwa über einen regelmässigen Goldsparplan – glättet Kursschwankungen und sichert sich langfristig einen stabilen Durchschnittspreis.
Sie haben über sechs Jahrzehnte Finanzgeschichte erlebt. Was unterscheidet den heutigen Goldmarkt von dem, den Sie einst kennengelernt haben?
In den Anfangsjahren nach der Wiederzulassung des Goldhandels galten feste Leitkurse, Preisschwankungen waren gering, und gehandelt wurde per Telefon oder Fernschreiber. Termingeschäfte spielten kaum eine Rolle. Mit der Freigabe des Goldpreises und moderner Handelssysteme wurde der Markt professioneller und beweglicher. Doch eines blieb unverändert: Anleger vertrauen bis heute auf die physische Lieferung und den persönlichen Kauf – ob am Schalter oder online. Gold steht nicht für Spekulation, sondern für Verlässlichkeit und Substanz.
Wenn Sie heute auf Ihren Lebensweg blicken – was war Ihre wichtigste Lehre im Umgang mit Gold und Krisen?
Deflation gilt als Feind der Wirtschaft – darum streben Zentralbanken eine moderate Inflation an. Doch selbst steigende Preise ändern nichts an der Bedeutung von Gold: Die Kosten für Förderung und Verarbeitung steigen mit, wodurch sein innerer Wert erhalten bleibt. Selbst in Phasen wirtschaftlicher Erholung kann es zwar zu Rücksetzern kommen, langfristig jedoch treiben Inflation und industrielle Nachfrage – etwa aus der Raumfahrt oder Elektronik – den Preis. Gold ist eben nicht nur Anlage-, sondern auch Industriemetall. Wenn auch nicht immer sofort, so hat Gold über Jahrzehnte hinweg seinen Wert bewiesen.
Bildquelle: KI generiert
Immer aktuell informiert: Folgen Sie pro aurum
So verpassen Sie nichts mehr! Informationen und Chartanalysen, Gold– und Silber-News, Marktberichte, sowie unsere Rabattaktionen und Veranstaltungen.
Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter
Der pro aurum-Shop
Die ganze Welt der Edelmetalle finden Sie in unserem Shop: proaurum.ch