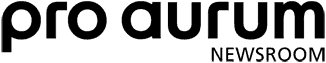Von Sommerflaute keine Spur, das Jahr 2024 verläuft für den Goldpreis bislang ausgesprochen erfreulich. Verkaufsargumente wurden konsequent ignoriert und haben dem gelben Edelmetall bis September zu einer Performance von über 25 Prozent verholfen.
Im ersten Quartal zog das gelbe Edelmetall besonders kräftig an und überwand die Marke von 2.200 Dollar. Im zweiten Quartal folgten mit dem Überwinden der Hürden von 2.300 und 2.400 Dollar die nächsten Meilensteine, was den Boden bereitete, um am 16. August erstmals über 2.500 Dollar pro Feinunze zu schiessen. Und im September nahm die Krisenwährung sogar die Marke von 2.600 Dollar ins Visier.
Diverse Korrelationen haben versagt
Als besonders bemerkenswert kann man bei dieser Kursrally festhalten, dass einige Korrelationen – die in der Vergangenheit für einen fallenden Goldpreis gesprochen haben – komplett versagt haben. Beispiel Konsumentenpreise: Der seit Generationen wirksame Inflationsschutz tendierte bergauf, obwohl in der Eurozone und in den USA die Teuerungsraten auf dem niedrigsten Stand seit über drei Jahren abgerutscht sind. Verantwortlich für den nachlassenden Inflationsdruck waren vor allem die deutlich gesunkenen Energiepreise. In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, dass der Erhalt von Kaufkraft bei Gold vor allem auf lange Sicht funktioniert.
Ausserdem reagierte das gelbe Edelmetall relativ „cool“ auf den massiven Verkaufsdruck europäischer und nordamerikanischer Investoren. Dieser machte sich im ETF-Marktsegment durch hohe Goldabflüsse besonders stark bemerkbar, die durch zwei Auffälligkeiten gekennzeichnet waren. Während nämlich asiatische ETFs relativ hohe Goldzuflüsse verzeichnet haben, trennten sich europäische und nordamerikanische Investoren im grossen Stil von ihren Gold-ETFs. Während diesseits des Atlantiks in den ersten acht Monaten 58,4 Tonnen Gold aus ETFs abgeflossen sind, schlug jenseits des Atlantiks ein Minus von 34,7 Tonnen zu Buche. Interessant dabei: In Asien, wo dieses Marktsegment in den vergangenen Jahren eher ein Schattendasein gefristet hat, stockten asiatische ETF-Investoren ihre Bestände an „Papiergold“ um 46,2 Tonnen auf.
Fast 29 Tonnen Gold landeten in diesem Jahr allein in China, wo die relativ schwachen Konjunkturperspektiven sowie die eingebrochenen Immobilienpreise und labilen Aktienmärkte einen starken Appetit auf die Krisenwährung ausgelöst haben. Investments in ausländische Aktienmärkte kommen für chinesische Privatanleger aufgrund der bestehenden Kapitalmarktkontrollen nicht als Alternative infrage. Hinsichtlich ETFs existiert mit Blick auf die asiatische Wachstumsregion enormes Nachholpotenzial, da sich dort die in ETFs gehaltenen Goldmengen gegenwärtig auf lediglich 184,6 Tonnen belaufen. Weil der erste Gold-ETF in den USA bereits 2003 auf den Markt kam und in Europa ein Jahr später, haben sich in diesen Regionen die Goldbestände innerhalb von mehr als 20 Jahren auf nunmehr 1.617,8 Tonnen (USA) bzw. 1.327,0 Tonnen (Europa) sukzessive erhöht.
Schwache Nachfrage bei Schmuck und Goldmünzen
Für die ersten sechs Monate dieses Jahres meldete der World Gold Council (WGC) vor allem zwei Marktsegmente mit enttäuschender Nachfrage – der Schmucksektor sowie der Bereich Goldmünzen. Die beiden wichtigsten Marktplayer im Bereich Schmuck – China und Indien – verzeichneten ein markantes Nachfrageminus, was vor allem auf den deutlich gestiegenen Goldpreis zurückzuführen war. In der Vergangenheit sind sowohl Chinesen als auch Inder durch ihre Preissensitivität aufgefallen und haben sich bei hohem Preisniveau mit Schmuckkäufen zurückgehalten. Aus China und Indien stammen derzeit mehr als 61 Prozent der globalen Schmucknachfrage, die sich im ersten Halbjahr von 864,2 auf 771,3 Tonnen (–10,7 Prozent) reduziert hat. Überdurchschnittlich stark nachgelassen hat das Schmuckinteresse vor allem in China, wo im ersten Halbjahr gegenüber der vergleichbaren Vorjahresperiode ein regelrechter Einbruch von 327,6 auf 270,7 Tonnen (–17,4 Tonnen) zu Buche schlug. Deutlich geringer fiel das Minus in Indien aus. Dort stellte sich nämlich im selben Zeitraum ein Nachfragerückgang 220,5 auf 202,0 Tonnen (–8,4 Prozent) ein.
Einen besonders heftigen Nachfrageeinbruch meldete der WGC bei Goldmünzen. Von Januar bis Juni 2024 ist nämlich auf Jahressicht ein Rückgang von 178,9 auf aktuell 118,6 Tonnen (–33,7 Prozent) registriert worden. Noch stärker eingebrochen sind in den ersten acht Monaten die von der US Mint ausgelieferten (frisch geprägten) Goldmünzen der Marke „American Eagles“. Während in der vergleichbaren Vorjahresperiode die Stückzahlen eine Goldmenge von 869.000 Feinunzen repräsentiert haben, kollabierte der Absatz 2024 auf lediglich 307.000 Unzen (–64,7 Prozent). Dass sich der Investmentsektor im ersten Halbjahr angesichts eines Nachfragerückgangs von 529,0 auf 454,3 Tonnen (–14,1 Prozent) ausgesprochen schwach entwickelt hat, lag auch an den hohen ETF-Abflüssen, die sich von 49,7 Tonnen (H1 2023) auf 120,1 Tonnen (H1 2024) mehr als verdoppelt haben. Einen Lichtblick stellte lediglich das Teilsegment Goldbarren dar. Dieses verzeichnete nämlich einen Zuwachs im zweistelligen Prozentbereich, schliesslich war hier im Berichtszeitraum ein Anstieg der Nachfrage von 351,0 auf 406,9 Tonnen (+15,9 Prozent) registriert worden.
Eine markant niedrigere Münznachfrage können wir von pro aurum durchaus bestätigen, da in diesem Jahr phasenweise die Verkäufer von Goldmünzen eindeutig in der Überzahl waren und die verbliebenen Käufer aufgrund der niedrigeren Aufgelder ältere Jahrgänge bevorzugten. Nach der starken Performance handelten offensichtlich viele Goldbesitzer nach dem unwiderlegbaren Motto: „An Gewinnmitnahmen ist noch niemand gestorben.“ Mittlerweile habe ich aber den Eindruck, dass sich viele potenzielle Goldkäufer nun eine Korrektur wünschen, um günstiger einsteigen zu können. Man darf daher gespannt sein, ob sich deren Wünsche erfüllen werden[JB1] .
OTC-Sektor beschert dem Goldpreis Rückenwind
Die Analysten des WGC meldeten in ihren Ende Juli veröffentlichten, quartalsweise erscheinenden „Gold Demand Trends“, dass sich in H1 das globale Goldangebot durch den Minen- und Recyclingsektor (ohne Hedging-Transaktionen) von 2.387,8 auf 2.472,1 Tonnen (+3,5 Prozent) erhöht hat, während bei der globalen Goldnachfrage (ohne OTC-Sektor) ein Minus von 2.159,6 auf 2.044,2 Tonnen (–5,3 Prozent) zu Buche schlug. Laut den Lehren der Betriebswirtschaft hätte dies den Goldpreis eigentlich belasten müssen. Ungeachtet dieses Sachverhalts tendierte die Krisenwährung weiter bergauf und markierte mehrfach neue Allzeithochs.
Laut WGC war die diesjährige relative Stärke des Goldpreises vor allem auf den OTC-Sektor (Over the Counter) zurückzuführen. Dieser umfasst u. a. die Terminmärkte, wo auf dem Papier viel Gold in Form von Futures & Optionen gehandelt wird. Diese sind allerdings nur in geringem Umfang durch physische Goldbestände hinterlegt. Im ersten Halbjahr war in diesem Marktsegment auf Basis der WGC-Daten ein Kaufvolumen in Höhe von 397,1 Tonnen registriert worden. Damit wurde der Vorjahreswert in Höhe von 251,2 Tonnen um 58,1 Prozent übertroffen.
Unter grossen Terminspekulanten (Non-Commercials) herrscht laut der US-Aufsichtsbehörde Commodity Futures Trading Commission (CFTC) weiterhin ein stark ausgeprägter Optimismus. Seit Ende Dezember haben diese hochspekulativen Marktakteure ihre Long-Seite um mehr als 50.000 Kontrakte aufgestockt und zugleich ihr Short-Exposure um fast 25.000 Futures reduziert. Dadurch erhöhte sich deren Netto-Long-Position (mehrheitlich optimistisch gestimmt) bis zum 10. September von 207.700 auf 282.500 Kontrakte (+36,0 Prozent). Da sich ein Gold-Future auf 100 Feinunzen Gold bezieht, repräsentiert allein diese Entwicklung ein Kaufvolumen von über 232 Tonnen.
Zentralbanken stocken ihre Goldreserven auf
Wie in den Jahren zuvor, liefern die Aktivitäten der internationalen Notenbanken zusätzliche Argumente zum Kauf von Gold: Die einen halten an ihren hohen Goldbeständen fest und die anderen treten weiterhin als Käufer in Erscheinung. In den ersten sechs Monaten erhöhten sich deren Goldreserven per Saldo bislang von 459,8 auf 483,3 Tonnen (+5,1 Prozent). Besonders aussagekräftig wird das Verhalten der Zentralbanken unter langfristigen Aspekten. Seit dem Jahr 2010 schwankten deren jährliche Käufe zwischen 79,2 Tonnen (2010) und 1.081,9 Tonnen (2022). Insgesamt summierten sie sich auf 8.275 Tonnen. Früher nannte man diese Institutionen einmal „Währungshüter“. In den vergangenen Jahrzehnten änderte sich dies aufgrund ihrer expansiven Geldpolitik. Wenn solch ausgewiesene Geldexperten Gold kaufen, sollten Privatanleger hellhörig werden und ihre Goldreserven ebenfalls aufstocken.
Mein ganz persönlicher Ausblick: Angesichts deutlich gestiegener Zinsen und des Comebacks positiver Realzinsen hat mich die starke Performance des Goldpreises sehr überrascht. Dadurch wurden viele Theorien der vergangenen beiden Jahrzehnte mehr oder weniger über den Haufen geworfen. Was genau die Abkopplung vom Realzins bewirkt hat, wird unter den führenden Analysten konträr diskutiert. Meiner Meinung nach befinden wir uns in einer Ära der historischen Verschiebung der globalen Sicherheitsarchitektur. Es bilden sich gerade neue Machtblöcke: auf der einen Seite westliche Industrienationen unter der Führung der USA und auf der anderen Seite BRICS-Staaten unter der Führung von China. Dies führt im letztgenannten Block zum Bestreben, Währungsreserven anders bzw. neu zu strukturieren. Der US-Dollar wird verkauft und ein Teil der Erlöse fliesst in Gold.
Dennoch gibt es an den Goldmärkten natürlich auch Risiken, wenngleich der Bullenmarkt meiner Meinung nach den Höhepunkt noch lange nicht erreicht hat. Blickt man z. B. auf den Terminmarkt in den USA, so haben sich bei Gold-Futures mittlerweile fast rekordhohe Long-Positionen gebildet. Das war in der Vergangenheit sehr oft der Trigger für Korrekturen. Spekulativ und kurzfristig orientierte Investoren sind aktuell wohl etwas zu optimistisch, aber auf lange Sicht verfügt die altbewährte Krisenwährung nach wie vor über glänzende Perspektiven. Ronald-Peter Stöferle, ein erfahrener Fondsmanager der Liechtensteiner Vermögensverwaltung Incrementum AG und Mitautor der weltweit angesehenen jährlichen Goldstudie „In Gold We Trust“, hält bis Ende dieses Jahrzehnts einen Anstieg auf 4.800 Dollar pro Feinunze für möglich. Für mich scheint dies ein realistisches und nachvollziehbares Szenario zu sein.
Bildquelle: KI generiert
Immer aktuell informiert: Folgen Sie pro aurum
So verpassen Sie nichts mehr! Informationen und Chartanalysen, Gold– und Silber-News, Marktberichte, sowie unsere Rabattaktionen und Veranstaltungen.
Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter
Der pro aurum-Shop
Die ganze Welt der Edelmetalle finden Sie in unserem Shop: proaurum.ch