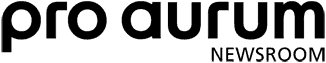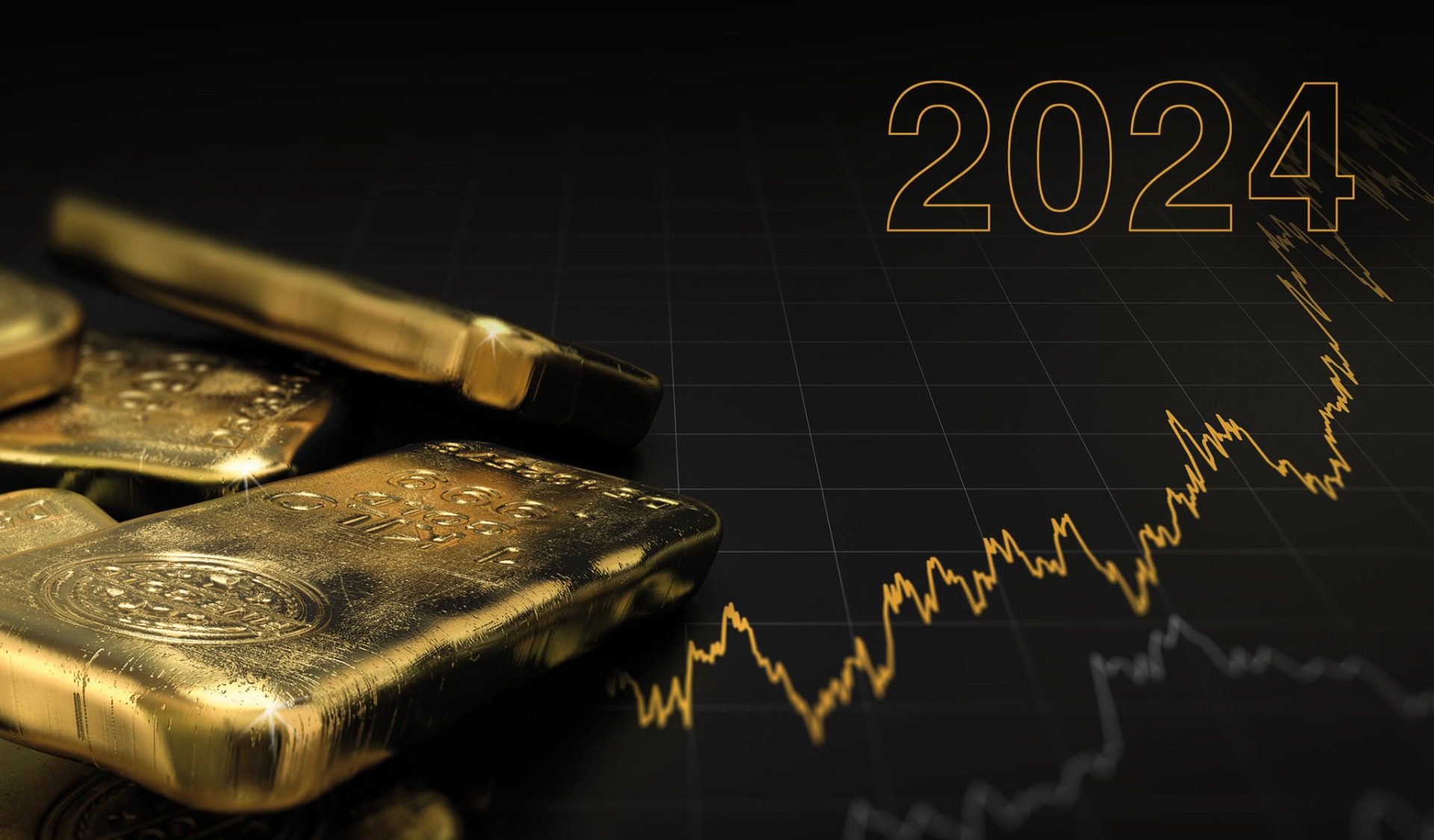Derzeit deutet einiges darauf hin, dass mit Blick auf den Goldpreis 2024 ein ausgesprochen guter Jahrgang wird. Eine noch höhere Performance wurde letztmals im Jahr 2010 erzielt. Gründe zum Kauf gab es zuhauf.
Euro-Jahresperformance aktuell bei 35,1 Prozent
Auf der Website goldprice.org kann man tagesaktuell und auf einen Blick die diesjährige Performance des Goldpreises sowie die Kursgewinne vergangener Jahre (seit 2009) in neun wichtigen Währungen erfahren. Seit dem Jahreswechsel hat sich das gelbe Edelmetall in Euro gerechnet um 35,1 Prozent verteuert und erzielte auf Dollarbasis eine Performance in Höhe von 28,4 Prozent (Stand: 16.12.24). Deutlich höhere Wertsteigerungen verzeichnete die Krisenwährung in japanischen Yen (+40,2 Prozent) und kanadischen Dollars (+38,0 Prozent).
In der Weltleitwährung Dollar entwickelte sich Gold in den Monaten März (+9,2 Prozent), Juli (+5,3 Prozent) und September (+5,3 Prozent) besonders erfreulich. Obwohl viele Länder – insbesondere die BRICS-Staaten – ihre Abhängigkeit vom Dollar reduzieren möchten und deshalb eine Währungsalternative planen, bewies die US-Währung angesichts der Inflation an geopolitischen Krisen ein hohes Mass an relativer Stärke und übertraf bis dato sogar die Jahresperformance wichtiger Aktienindizes wie DAX (+21,4 Prozent) und Dow Jones (+16,3 Prozent). Im Februar kostete eine Feinunze Gold zeitweise weniger als 2.000 Dollar. Danach ging es Schlag auf Schlag und die Krisenwährung erzielte zahlreicher Rekordhochs. Ende Oktober setzte sie dann knapp unterhalb von 2.800 Dollar zu einer signifikanten technischen Korrektur von in der Spitze fast zehn Prozent an.
Für die diesjährige Kauflaune an den Goldmärkten gab es viele Gründe. Obwohl dies- wie jenseits des Atlantiks die Anleiherenditen in der ersten Jahreshälfte markant bergauf tendierten, zeigte sich Gold davon unbeeindruckt und überwand bis Ende Juni relativ problemlos die Marken 2.100 bis 2.400 Dollar. Normalerweise wird dem zins- und dividendenlosen Edelmetall in Zeiten steigender Zinsen und den daraus resultierenden erhöhten Opportunitätskosten (-> Zinsverzicht) eine nachlassende Attraktivität zugestanden. Doch die Vergangenheit hat gezeigt, dass auf den Goldpreis die unterschiedlichsten Kräfte wirken. Belastungsfaktoren können auf der einen Seite ignoriert und/oder durch andere Faktoren kompensiert werden.
Was den Goldpreis stark beeinflusst hat
Als grösstes Marktsegment erweist sich bei Gold seit Jahren der Schmuckmarkt, der vor allem durch asiatische Käufer stark beeinflusst wird. Laut World Gold Council hat dieser in den vergangenen beiden Jahren allerdings an Bedeutung verloren. So hat sich z. B. die globale Schmuckproduktion von 2.231,1 Tonnen im Jahr 2021 auf 2.195,9 Tonnen (2022) bzw. 2.190,5 Tonnen (2023) reduziert. Und dieser Abwärtstrend scheint sich 2024 fortzusetzen, schliesslich war in den ersten neun Monaten ein Minus von über sieben Prozent gegenüber der vergleichbaren Vorjahresperiode registriert worden. Da Schmuckkäufer als preissensitive Nachfrager gelten, dürfte der stark gestiegene Goldpreis für diese Negativtendenz massgeblich verantwortlich gewesen sein. Zugleich dürfte die Schwächephase der chinesischen Wirtschaft das Interesse an Goldschmuck zusätzlich gedämpft haben.
Mehr als ausgeglichen wurde der oben erwähnte Negativfaktor durch die beiden Marktsegmente Terminmärkte und ETF-Sektor, wo ein steigender Goldpreis häufig keine „abschreckende“ Wirkung hat, sondern manchmal sogar das genaue Gegenteil verursacht – ein steigendes Kaufinteresse. So hat sich z. B. der Optimismus unter grossen wie kleinen Terminspekulanten im Jahresverlauf deutlich verstärkt. Grossspekulanten (Non-Commercials) haben ihre Netto-Long-Position (mehrheitlich optimistisch gestimmt) – gemessen vom Mitte Februar markierten Jahrestief – von 131.200 auf 329.500 Kontrakte mehr als verdoppelt (aktuell: 275.600 Kontrakte). Kleinspekulanten (Non-Reportables) gelang dieses „Kunststück“ zwar nicht, dennoch verzeichnete deren Netto-Long-Position in der Spitze einen Zuwachs um immerhin 95,5 Prozent von 15.500 auf 30.300 Futures (aktuell: 21.300 Futures).
Ein massiver Stimmungswechsel war 2024 im ETF-Sektor zu beobachten. Dort haben sich nämlich massive Goldabflüsse in Höhe von 113 Tonnen (Q1) im zweiten Quartal auf lediglich 7,1 Tonnen reduziert. Im dritten Quartal stellten sich sogar Zuflüsse von 94,7 Tonnen ein, sodass laut Daten des World Gold Council die Abflüsse von 244,2 Tonnen im Jahr 2023 – ohne Berücksichtigung des Dezembers – auf aktuell 10,5 Tonnen dahingeschmolzen sind. Besonders interessant: Obwohl in Europa der Ukraine-Krieg weiterhin tobt, verzeichneten europäische Gold-ETFs seit dem Jahreswechsel Abflüsse von 97,6 Tonnen, während sich in Asien die Zuflüsse von 19,3 Tonnen (2023) bis dato auf 69,5 Tonnen mehr als verdreifacht haben.
Notenbanken vertrauen weiter auf Gold
Die diesjährigen Goldkäufe der Notenbanken wurden ebenfalls für die rasante Rally des Goldpreises mitverantwortlich gemacht. Vor allem die BRICS-Staaten möchten ihre Abhängigkeit von Weltreservewährungen wie Dollar und Euro reduzieren und damit auch das damit verbundene Sanktionsrisiko senken. Ziel sei das Fördern einer multipolaren Weltwirtschaft, um nicht zu stark von westlich dominierten Finanzsystemen abhängig zu sein. In diesem Jahr vertrauten aber auch verstärkt europäische Zentralbanken (Polen, Ungarn, Türkei) auf die altbewährte Krisenwährung Gold. In den ersten drei Quartalen haben sich laut World Gold Council die Nettokäufe der Notenbanken sukzessive von 305,2 Tonnen (Q1) auf 202,2 Tonnen (Q2) bzw. 186,2 Tonnen (Q3) reduziert. Nur zur Erinnerung: In den vergangenen zehn Jahren haben die Notenbanken weltweit ihre Goldreserven um über 6.000 Tonnen aufgestockt – ein Schelm, wer Böses dabei denkt?
Inflation und Trump werden ignoriert
Der Goldpreis hat in diesem Jahr zweifellos positiv überrascht – insbesondere, wenn man den markanten Inflationsrückgang in den USA und der Eurozone sowie die Reaktion der Goldmärkte auf Trumps Wahlsieg Anfang November berücksichtigt.
Normalerweise lässt nämlich die Anziehungskraft von Gold bei sinkendem Inflationsrisiko nach. Offensichtlich ging man an den Goldmärkten nicht davon aus, dass dieser Rückgang von nachhaltiger Natur ist. Und mit dieser Einschätzung lag man offensichtlich richtig, schliesslich zog die jährliche Inflation in der Eurozone von 1,7 Prozent (September) auf 2,3 Prozent (November) bereits spürbar an. Damit sind in Deutschland negative Realzinsen wieder zurückgekehrt, schliesslich kann man mit zehnjährigen Bundesanleihen, die aktuell bei 2,2 Prozent p. a. rentieren, die Inflation nicht ausgleichen. Und in Phasen negativer Realzinsen hat sich der Goldpreis in der Vergangenheit häufig relativ gut entwickelt.
Der überraschend deutliche Wahlsieg Donald Trumps und der darauffolgende temporäre Rückgang des Goldpreises dürften ebenfalls viele Investoren überrascht haben, da man Trump eher das Schaffen neuer Krisenherde zutraut als das Bewältigen der bereits aufgestauten. Weil Trump im Wahlkampf das Senken von Steuern und das massive Kürzen staatlicher Ausgaben angekündigt hatte, wechselten Finanzinvestoren aufgrund der Aussicht auf eine wirtschaftsfreundliche Politik wieder in riskantere Geldanlagen wie Aktien und Kryptowährungen. Gold war während dieser Phase der Neuorientierung weniger gefragt, was sich mittlerweile aber wieder geändert hat. Mitte Dezember hat das gelbe Edelmetall mehr als die Hälfte der technischen Korrektur wieder aufgeholt und notiert mit fast 2.660 Dollar lediglich fünf Prozent unter seinem alten Rekordhoch.
Bildnachweis: Olivier Le Moal
File#: 629743180
Bildquelle: istockphoto.com
Immer aktuell informiert: Folgen Sie pro aurum
So verpassen Sie nichts mehr! Informationen und Chartanalysen, Gold– und Silber-News, Marktberichte, sowie unsere Rabattaktionen und Veranstaltungen.
Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter
Der pro aurum-Shop
Die ganze Welt der Edelmetalle finden Sie in unserem Shop: proaurum.ch