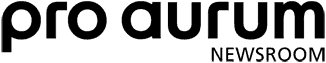Gold- und Silberbarren ziehen seit Jahrtausenden Menschen in ihren Bann – allerdings spielen dabei wohl nicht in erster Linie die Gestaltung und Ästhetik der Barren eine Rolle, sondern der innere Wert. Als Sammelgebiet stellen Barren eine Nische dar – jedoch mit leidenschaftlichen Sammlern, die für Barren mit Geschichte teils stattliche Aufpreise zahlen.
Goldbarren von Raffinerien wie Argor S.A. Chiasso, Schöne Edelmetaal, Johnson Matthey oder Golden West Refining – diese Namen sieht man normalerweise nicht im Standardsortiment eines Edelmetallhändlers. Was macht diese goldenen und silbernen Güsse oder Prägungen aber so besonders? „Bereits im Altertum wurden Edelmetalle in Barrenform gehandelt, lange bevor sich Münzgeld weltweit durchsetzte“, berichtet Sven Jacobsohn, Numismatiker bei pro aurum.
Im alten Ägypten und Vorderasien nutzte man Gold und Silber nach Gewicht – in Form von Rohbarren, Ringen oder Talenten – als Zahlungsmittel und Schatzspeicher. Auch in der griechisch-römischen Antike prägte man zwar Münzen, doch grössere Mengen Edelmetall wurden oft als ungemünzte Barren oder Klumpen bewegt, zum Beispiel für Tributzahlungen oder Handelszwecke. Archäologische Funde belegen dies eindrucksvoll: Silberbarren des Römischen Reiches um 400 n. Chr. wogen etwa ein halbes Kilogramm und trugen eingestempelte Herkunftsangaben – etwa den Namen der Werkstatt und den Feingehalt.
Guss, Prägung, Punzen: Formen und Herstellung historischer Barren
Historische Gold- und Silberbarren treten in vielfältigen Formen auf, die sowohl von der Herstellungstechnik als auch von lokalen Gepflogenheiten abhängen. Grundsätzlich unterscheidet man gegossene und geprägte Barren. Früher dominierte klar der Guss: Das Schmelzen und Eingiessen von Metall in Formen ist eine seit dem Altertum übliche Methode, die sich im Kern bis heute kaum verändert hat. „Das flüssige Gold oder Silber wurde in eine Form gegossen, welche oft eine bestimmte Gewichtseinheit vorgab. War der Barren erkaltet, brachte man die wichtigsten Angaben per Stempel auf – im Vergleich zu heute nicht immer vollständig: Gewicht, Feinheit des Metalls, Auftraggeber, Hersteller oder verantwortlicher Assayeur“, erklärt Numismatiker Sven Jacobsohn. „Gegossene Barren sind immer Unikate mit charakteristischen Merkmalen: leicht unebene Oberflächen, abgerundete Kanten, mehr oder weniger stark ausgeprägte Erstarrungslinien, individuelle Formen; teilweise mit Justierspuren, da überschüssiges Material mit der Feile abgenommen wurde.“
Demgegenüber kamen industriell geprägte Barren erst im späten 19. und vor allem im 20. Jahrhundert auf. Bei einem Prägebarren wird das Metall zunächst zu einem genormten Rohling (meist durch Strangguss und Walzen zu einem Blechstreifen) vorgeformt, um dann mittels Stempelpresse geprägt zu werden. Dies erlaubt sauberere Oberflächen, exakte Kanten und feinere Aufschriften oder Logos.
Europäische Handels- und Bankbarren
Viele historische Barren-Schätze kommen aus Europa – wenn auch weniger spektakulär auf den ersten Blick. Hier sind es vor allem historische Bank- und Handelsbarren von bekannten Scheideanstalten, die Sammler interessieren. Ein Beispiel sind die Goldbarren der traditionsreichen Rothschild-Bank in London. N.M. Rothschild & Sons betrieb ab 1852 die Royal Mint Refinery und prägte über ein Jahrhundert lang Goldbarren für den internationalen Markt. „Viele ehemals aktive Barren-Hersteller gibt es heute nicht mehr – ihre historischen Produkte sind dadurch limitiert und bei Liebhabern begehrt“, betont Sven Jacobsohn, der in der Numismatik-Abteilung von pro aurum auch historische Barren aus Gold und Silber prüft.
Neben Rothschild werden in Europa alte Barren von Thurn & Taxis (eine Fürstenfamilie, die im 19. Jahrhundert ebenfalls Goldgeschäfte betrieb), von Engelhard (einem US-Unternehmen mit europäischer Präsenz) oder von belgischen und niederländischen Raffinerien (Boschmans, Buggenhout, Schoonhoven) gesucht. Manche tragen Logos oder Prägejahre, die nostalgisch anmuten. Für Anleger und Sammler bieten historische Handelsbarren oft einen doppelten Reiz: Sie verbinden den reinen Materialwert mit geschichtlichem Hintergrund.
Der heutige Sammlermarkt für historische Barren
Der Markt für historische Edelmetallbarren ist ein kleines, spezialisiertes Sammelgebiet. Im Vergleich zur Münzsammlung ist die Zahl engagierter Barrensammler überschaubar – allein schon aufgrund des begrenzten Angebots. Historische Barren wurden in deutlich geringerer Stückzahl hergestellt und sind heute entsprechend selten am Markt zu finden.
Mit dem starken Anstieg des Goldpreises lässt sich zudem beobachten, dass sich viele Sammler zunehmend auf kleinere Stückelungen konzentrieren. Für einen 100-Gramm-Goldbarren muss man heute mehr als 3.500 Euro mehr zahlen als noch vor zwei Jahren – eine Preisentwicklung, die auch Einfluss auf das Sammelverhalten hat. Ähnliche Tendenzen zeigen sich im Silberbereich, wobei hier weniger der Materialwert im Vordergrund steht, sondern vielmehr das äusserst geringe Vorkommen kleiner Gewichtseinheiten. Diese wurden in der Vergangenheit vor allem für industrielle Zwecke hergestellt und waren für den privaten Erwerb kaum vorgesehen.
Die Community der Barrensammler ist klein, aber gut vernetzt. In spezialisierten Foren tauschen sich Sammler über Stempelvarianten, Gewichtsunterschiede oder Produktionsbesonderheiten aus. Sven Jacobsohn kann diese Faszination gut nachvollziehen: „Ich teile die Freude an einem schönen Gussbarren mit ausgeprägten Erstarrungslinien.“
Bildquelle: Composing pro aurum
Immer aktuell informiert: Folgen Sie pro aurum
So verpassen Sie nichts mehr! Informationen und Chartanalysen, Gold– und Silber-News, Marktberichte, sowie unsere Rabattaktionen und Veranstaltungen.
Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter
Der pro aurum-Shop
Die ganze Welt der Edelmetalle finden Sie in unserem Shop: proaurum.ch