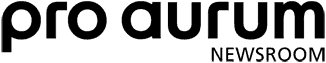Willem Spelten, Konzernsprecher bei Mercedes Benz, über seine vielfältige Karriere beim Stuttgarter Autobauer, die kulturellen Herausforderungen in Japan und Indien, die Bedeutung von Empathie in der globalen Kommunikation und den Umgang mit internationalen Pressevertretern.
Herr Spelten, Sie sind seit 1999 bei Mercedes-Benz und haben in dieser Zeit Stationen im Einkauf, Vertrieb und später in der Kommunikation durchlaufen – sowohl für Pkw als auch für Nutzfahrzeuge. Was waren rückblickend die prägendsten Meilensteine?
Ich habe meine Karriere mit einem Dualen Studium bei Mercedes-Benz begonnen und war zunächst im Einkauf für Pkw tätig. Anschliessend wechselte ich in den Vertrieb von Nutzfahrzeugen, wo ich unter anderem in Luxemburg Lkw, Busse, Transporter und Unimog verkaufte. Danach übernahm ich die Kommunikation für Smart und begleitete die spannende Umstellung zur ersten vollelektrischen deutschen Automarke. Parallel verantwortete ich bei Mercedes-Benz die Kommunikation für Lifestyle, Sport und Designthemen. Später leitete ich von Japan aus die Kommunikationsaktivitäten für Mitsubishi Fuso und die indische Marke BharatBenz.
Vor eineinhalb Jahren übernahmen Sie in Stuttgart die Konzernkommunikation – und damit auch die Aufgabe des Pressesprechers von Mercedes-Benz. Welche „Skills“ sind für diese Rolle Ihrer Meinung nach unverzichtbar?
Für diese Aufgabe gibt es kein festgelegtes Stärken-Set, aber eine ausgeprägte Auffassungsgabe und breites Interesse sind essenziell. Man muss permanent Informationen aufnehmen, insbesondere aus internationalen und branchenspezifischen Nachrichten, und jederzeit sprechfähig sein – sei es zu Finanzen, Personalthemen oder anderen Unternehmensfragen. Eine Schlüsselrolle spielt auch die interne Kommunikation: Rund 160.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit müssen verständlich und zielgerichtet informiert werden, was eine andere Tonalität erfordert als die Ansprache von Investoren oder Medien. Dazu kommt der Aufbau stabiler Beziehungen zu Journalistinnen und Journalisten sowie die enge Beratung der Vorstände, insbesondere in intensiven Phasen der Nachrichtenlage. Flexibilität, Präzision und schnelles Handeln machen diesen Job so herausfordernd und zugleich faszinierend.
Ihre Position bringt sicher ein hohes Stresslevel mit sich. Wie schaffen Sie es, Ihre Work-Life-Balance zu wahren und auch mal abzuschalten?
Meine Work-Life-Balance verdanke ich vor allem einem grossartigen Team. Es braucht Menschen, die genauso leidenschaftlich sind und Freude daran haben, auch im Auge des Sturms zu arbeiten. Dieser Job ist stressig, aber die Nähe zu Entscheidungen und die Relevanz der Themen machen ihn zugleich motivierend. Mein Team arbeitet sehr souverän und eigenständig, was besonders in Krisensituationen hilft. Wir stimmen uns eng ab, aber jeder handelt auch autark – und genau das macht die Arbeit nicht nur steuerbar, sondern auch freudvoll.
Sie haben es bereits erwähnt: Sie waren während Ihrer Karriere für die Kommunikation in Japan und Indien verantwortlich. Welche Rolle spielte dabei kulturelle Kompetenz und worin unterscheiden sich diese beiden Länder Ihrer Meinung nach besonders stark?
Empathie spielt in diesem Kontext eine zentrale Rolle – und das ist etwas, das schwer zu trainieren ist. Entweder man bringt sie mit oder sie fehlt. Im internationalen Austausch, insbesondere in Kulturen, die so unterschiedlich sind wie Japan und Indien, ist diese Fähigkeit unverzichtbar. Beide Länder sind extrem in ihrer kulturellen Prägung und unterscheiden sich grundlegend in ihrer Arbeitsweise und Mentalität.
Mit Teams aus beiden Ländern gleichzeitig zu arbeiten, war zweifellos eine besondere Herausforderung, die aber stets gut funktioniert hat. Dabei war es entscheidend, die Kommunikation den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. In Japan sind Höflichkeit und Geduld essenziell. Es ist wichtig, dem System Zeit zu geben, Prozesse zu durchdenken und Entscheidungen reifen zu lassen – dafür werden sie dann mit höchster Präzision umgesetzt. In Indien hingegen erlebt man eine ganz andere Dynamik. Die Begeisterung und Aufgeschlossenheit der Teams sind bemerkenswert, und man gewinnt die Menschen oft sehr schnell für Ideen. Gleichzeitig war es meiner Erfahrung nach wichtig, regelmässig nachzufassen, um sicherzustellen, dass Absprachen tatsächlich wie geplant umgesetzt werden. Diese unterschiedlichen Herangehensweisen erfordern viel Flexibilität und Verständnis, aber genau das macht die Arbeit in solch kulturell unterschiedlichen Kontexten auch so bereichernd.
Über Ihre Zeit in Japan haben Sie sogar ein Buch geschrieben. Gibt es eine Anekdote daraus, die besonders prägend war und Ihre Erfahrungen dort treffend zusammenfasst?
Es gab sehr viele Erlebnisse, die so vermutlich nur in Japan passieren konnten. Etwa während der besonderen Herausforderungen der Covid-Pandemie. Unser Werk liegt in Kawasaki, direkt neben Tokio, wo Wohnraum extrem teuer und Platz oft Mangelware sind. Während der Pandemie haben wir für alle, die nicht direkt in der Produktion arbeiten mussten, Homeoffice-Lösungen eingeführt. Das war in Japan eine echte Neuerung, denn dort herrscht eine starke Präsenzkultur. Das führte zu einem unerwarteten Problem: Viele Wohnungen sind so klein, dass es keinen Platz für ein Homeoffice gibt. Gleichzeitig ist die Erwerbsquote von Frauen in Japan vergleichsweise niedrig, und traditionell sind viele von ihnen daran gewöhnt, dass die Ehemänner morgens um sieben Uhr das Haus verlassen und erst spät abends zurückkehren. Plötzlich sassen die Männer jedoch zu Hause – oft im Wohnzimmer – und der Platzmangel wurde sehr spürbar.
Welche Lösung gab es dafür?
Viele japanische Wohnungen haben grosse Wandschränke, sogenannte „Oshiire“, in denen tagsüber die Futons – also die Schlafmatten – aufbewahrt werden. Diese Schränke sind oft etwa 1,5 Meter tief. Und genau diese Wandschränke wurden kurzerhand zu Homeoffices umfunktioniert. Die Futons wurden heraus-, PC und Bürostuhl wurden eingeräumt, und meine Kollegen arbeiteten buchstäblich aus diesen Wandschränken heraus. Ich habe während der Pandemie also monatelang Videocalls mit Kollegen geführt, die in einem solchen Schrank sassen – ein Bild, das ich nie vergessen werde. Es zeigt, wie pragmatisch und erfinderisch die japanische Kultur mit Herausforderungen umgeht, selbst wenn es auf den ersten Blick vielleicht etwas skurril wirkt.
Welche Erfahrungen haben Sie im Umgang mit Pressevertretern aus diesen beiden Ländern gemacht?
Indiens Presselandschaft ähnelt jener Grossbritanniens oder der USA, ist aber durch die Vielzahl von Sprachen besonders. Presseinformationen müssen manchmal, je nach Region, in über zehn Sprachen übersetzt werden.
In Japan hingegen dominieren grosse Medienhäuser mit Millionenauflagen. Dort gibt es viele und sehr spezialisierte Journalisten, die sich dann intensiv mit einem relativ kleinen Thema wie beispielsweise nur dem Automobilbau befassen. Organisiert sind sie in Presseclubs, einer wirklich sehr japanischen Einrichtung: Journalisten arbeiten direkt in Ministerien wie Verkehr oder Infrastruktur und berichten exklusiv über alle Themen dieses Ministeriums. Diese Struktur existiert auch auf regionaler Ebene, für jede Provinz und viele lokale Verwaltungsorgane, was den Kontakt mit einer beeindruckenden Zahl an Journalisten erforderlich macht. Dieses System ist meines Wissens weltweit einzigartig und verlangt ein hohes Mass an Disziplin und Aufmerksamkeit, um sich darin sicher bewegen zu können.
In dieser Ausgabe unseres Kundenmagazins liegt der Fokus auf der Region Stuttgart. Welche Sehenswürdigkeiten oder Insidertipps der Schwabenmetropole würden Sie Touristen besonders ans Herz legen?
Wie könnte es anders sein: Das Mercedes-Benz Museum ist für mich ein absolutes Highlight. Es ist nicht nur eine Autoausstellung, sondern eine faszinierende Mischung aus Geschichts- und Technikmuseum. Beginnend im Jahr 1886 – mit der Erfindung des ersten Motors als Ersatz für das Pferd –, führt es spiralförmig nach unten durch die Zeitgeschichte bis in die Gegenwart. Das Museum begeistert die ganze Familie, selbst diejenigen, die sich weniger für Autos interessieren.
Stuttgart wird oft als „Kesselstadt“ bezeichnet, da die Innenstadt in einem Tal liegt. Doch die hügelige Landschaft sorgt für viele Hanglagen mit toller Aussicht. Ein wunderbarer Ort, um diese besondere Lage zu geniessen, ist der Biergarten „Teehaus“ auf einer Anhöhe zwischen Degerloch und der Stadtmitte. Von dort hat man einen fantastischen Blick über die Stadt und die umliegenden Weinberge, die teilweise bis in die Innenstadt reichen.
Für Feinschmecker empfehle ich das Restaurant Délice. Es liegt im alten Weinkeller eines Privathauses und hat eine intime Atmosphäre mit ganz wenigen Tischen. Gekocht wird in einer winzigen Küche, und das dreiköpfige Team – bestehend nur aus Koch, Kellner und Sommelier – sorgt für ein wirklich sehr schönes und leckeres Erlebnis. Die kreative Küche kombiniert Geheimtipp-Charme mit exzellenter Haute Cuisine.
Zum Abschluss eine Frage zur privaten Geldanlage: Welche Anlageklassen zählen für Sie zu den Must-haves und welche haben auf Ihrer Liste eher keine Priorität?
Ich gebe hier natürlich keine Anlageempfehlungen, aber es dürfte kaum überraschen: Ich bin ein grosser Anhänger der Mercedes-Benz-Aktie. Sie zählt zu den Must-haves in meinem Portfolio, nicht zuletzt wegen ihrer starken Dividendenrendite. Zusätzlich setze ich auf eine breit diversifizierte Strategie mit ETFs, die langfristig stabile Renditen ermöglichen. Ein besonderes Ritual ist für mich der Kauf von Goldmünzen: Jedes Jahr schenke ich meinen Söhnen eine Münze. Damit schaffe ich nicht nur einen bleibenden Wert, sondern auch eine persönliche Erinnerung. Später können sie die Münzen behalten oder für etwas Schönes nutzen – ganz wie sie möchten.
Bildquelle: © Mercedes-Benz AG
Immer aktuell informiert: Folgen Sie pro aurum
So verpassen Sie nichts mehr! Informationen und Chartanalysen, Gold– und Silber-News, Marktberichte, sowie unsere Rabattaktionen und Veranstaltungen.
Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter
Der pro aurum-Shop
Die ganze Welt der Edelmetalle finden Sie in unserem Shop: proaurum.ch